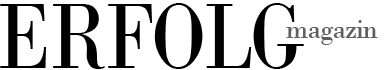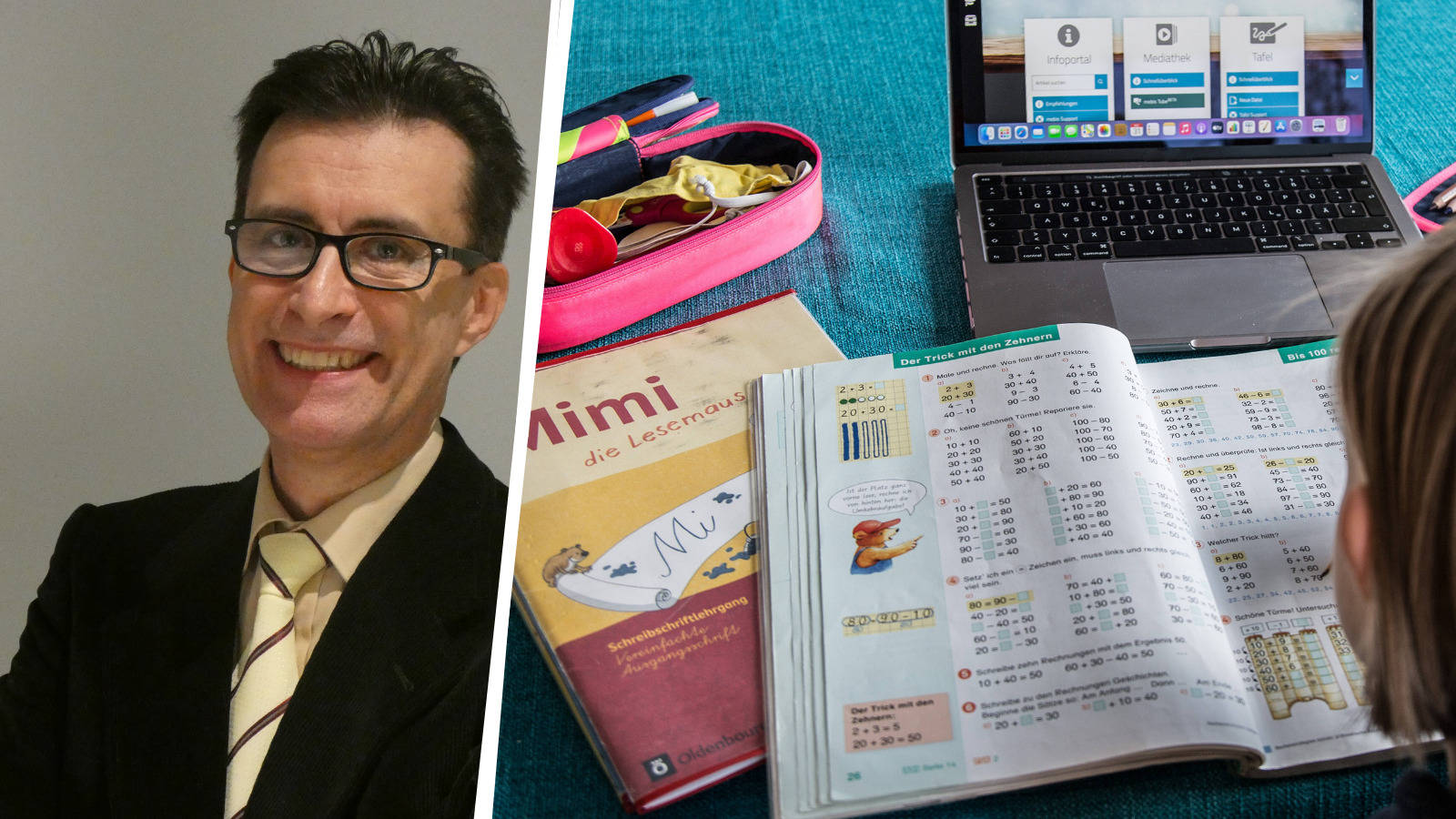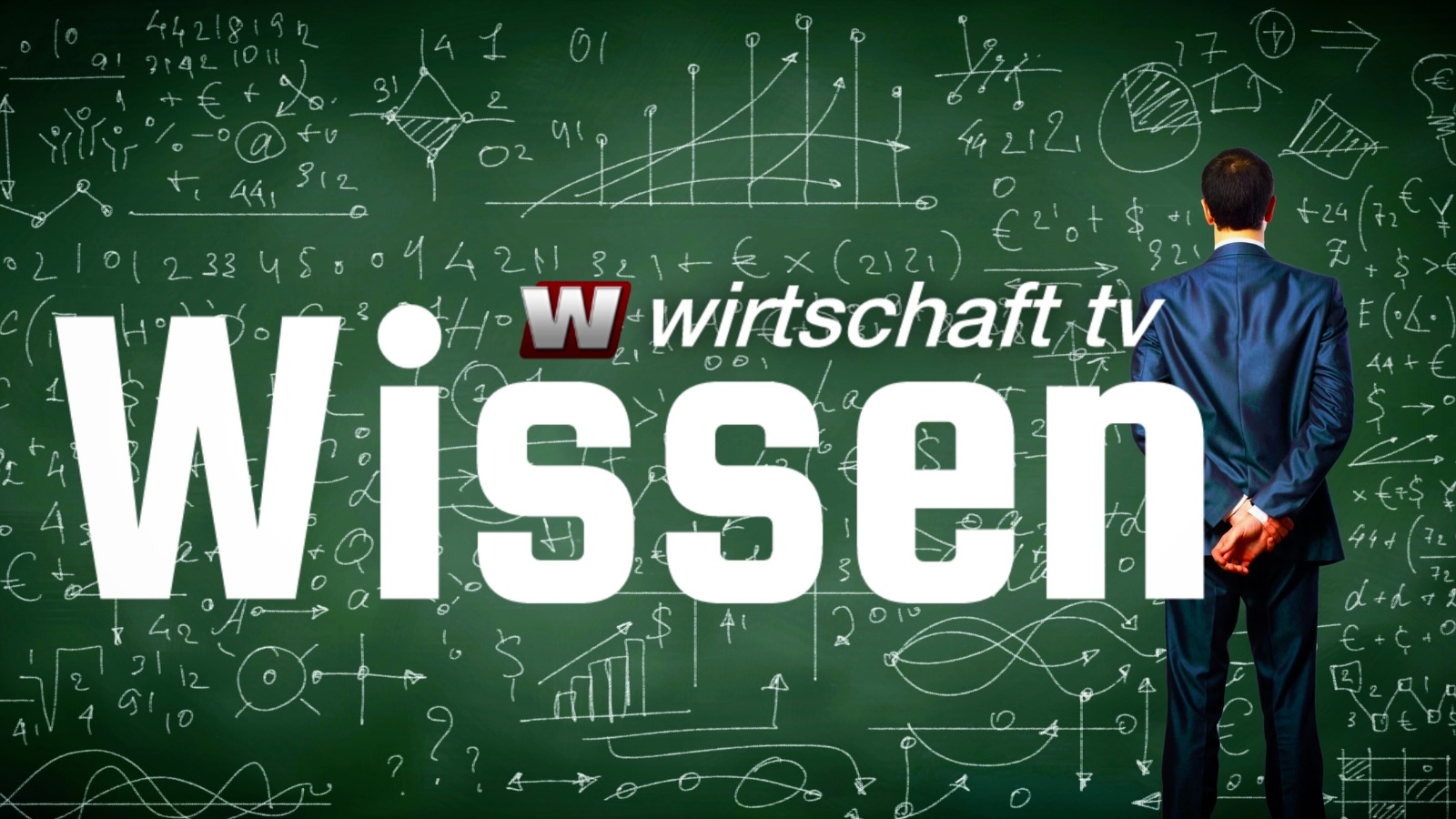Vom Außenseiter zum CEO? Warum der Schulhof-Stempel bleibt
Ein Gastbeitrag von Miriam Hoff
Prägt die Schulzeit unser Selbstbild unwiderruflich oder können wir uns von alten Schubladen befreien? Ein psychologischer Blick auf Identität, Zugehörigkeit und die Kunst, sich selbst neu zu erfinden.
Alte Rollen trotz neuer Lebensphase?
Wer auf dem Schulhof der quasselnde Klassenclown war, trägt diesen Ruf oft noch Jahre später wie eine knallrote Nase mehr oder weniger unsichtbar mitten im Gesicht. Und wer damals in der letzten Reihe zur »schüchternen Glühbirne« gehörte, fühlt sich auch im Vorstand oder beim Einstellungsgespräch noch so, als könne er jedem Moment im Erdboden versinken. Warum aber haften uns eigentlich die Etiketten aus Teenagertagen so hartnäckig an – selbst wenn wir längst beruflich durchgestartet sind und eigentlich denken, wir hätten unser Leben im Griff?
Psychologisch betrachtet ist die Jugend eine Phase tiefgreifender Identitätsbildung. Alles ordnet sich neu, das Gehirn bewertet und sortiert unentwegt – und das bevorzugt in Rollenbildern. Wir neigen in dieser Lebensphase besonders stark dazu, uns selbst und andere in Schubladen zu stecken, weil wir einerseits dazugehören wollen und andererseits große Angst vor Ausgrenzung haben. Wer ausgeschlossen wird, erlebt das als seelischen Schmerz – vergleichbar mit körperlicher Verletzung, das erlebe ich täglich in meiner Psychotherapie-Praxis. Solche Erlebnisse hinterlassen tiefe Spuren: Menschen, die in ihrer Schulzeit Mobbing oder Ausgrenzung erfahren haben, neigen später entweder zu überhöhter Leistung, um sich zu beweisen – oder tragen einen inneren »Loser-Stempel« mit sich herum. Das emotionale Gepäck dieser Zeit sitzt oft tief in unserem »Lebensrucksack«. Rollen wie »das Sport Ass«, »die Barbiepuppe«, »der Überflieger«, »der Loser« oder »der Nerd« entstehen früh – was oft durch kleine Insider-Witze begonnen hat, entwickelt sich schnell zum ausgeprägten Label. Dazu kommt die Macht der Gruppe und unschöne Kommentare von Lehrern, die das Ganze dann felsenfest zementieren. Diese Zuschreibungen prägen unser Selbstkonzept – bewusst oder unbewusst – und wirken auch im späteren Verhalten, in Bewerbungen, Meetings, Präsentationen noch stark nach. Viele Erwachsene leben (und leiden) unter einem Selbstbild, das gar nicht mehr zu ihrer Realität passt. Doch die Identifikation ist so stark und oftmals so unbewusst, dass man gar keine Chance hat, sich davon zu lösen. So sabotieren manche unbewusst ihren Erfolg, andere überkompensieren ein geringes Selbstbewusstsein über enorme Leistung oder Anpassung – wieder andere leiden unter dem »Imposter«, also Hochstapler-Syndrom, denn sie denken, früher oder später wird allen auffallen, dass sie ja doch (immer noch) der uncoole Außenseiter oder Loser sind. Aber auch positive Rollen wie der Schulschwarm, der/die Beliebte oder Lehrerliebling können später zum Problem werden. Wenn das Selbstwertgefühl an äußere Anerkennung geknüpft bleibt oder aber das Leben mit Höhen und Tiefen, die jeder nun mal hat, die vielleicht überhöhten Ansprüchen an das damalige rosarote Größenselbst zerstört, oder man nie gelernt hat, wirklich hart zu arbeiten, weil einem früher alles zugeflogen ist – dann kann der Fall recht tief sein.
Zeit für einen Neustart!
Es lohnt sich daher, die verstaubten Schulhof-Stempel einmal genauer anzuschauen – denn oft liegt genau darin der Schlüssel zu mehr Freiheit und echtem Selbstbewusstsein. Der Blick in den eigenen »Lebensrucksack« lässt erkennen, dass wir teilweise schwere Steine mit uns rumschleppen, die uns blockieren und die wir getrost loslassen dürfen, denn sie haben und hatten nie was mit uns zu tun.

Miriam Hoff ist approbierte Psychotherapeutin und auf die Diagnose sowie Behandlung bei Kinder und Jugendlichen spezialisiert.
Ihr Ratgeber »Therapie für die Seele« ist im April erschienen.
Beitragsbilder: Hans Keller
Weitere Beträge zum gleichen Thema