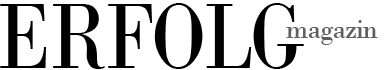Geschäftschance oder Geldgrab? Was der ESC der Wirtschaft bringt
Fünfzehn Jahre ist es her, dass Lena Meyer-Landrut als »unser Star für Oslo« mit 246 Punkten das begehrte silberne Mikrofon nach Deutschland holte. Ihr Sieg beim Eurovision Song Contest im Jahr 2010 entfachte nicht nur eine neue ESC-Euphorie, sie warf auch eine wirtschaftliche Frage auf: Welche deutsche Stadt soll das Event ausrichten?
Sehen und gesehen werden
Es dauerte nicht lang, bis sich die Liste der Bewerber gefüllt hatte: Insgesamt 23 Städte, darunter bekannte Namen wie Berlin, München und Köln, bewarben sich als Austragungsorte. Dass die Entscheidung letztlich auf Düsseldorf fiel, war auch für den NDR, eine Überraschung. Noch kurz zuvor nämlich hatte der Experte Jan Feddersen als eher unattraktiv beschrieben: »Ein unwichtiger Fußballklub, viel Modegetue, Tote Hosen und eine Biersorte, die nach aufgeschäumtem Rheinwasser schmeckt, ältlich nämlich«, schrieb er auf dem offiziellen Blog des Senders. Doch letztlich entschied wohl der Blick auf den Geldbeutel: Ein nicht zu unterschätzender Faktor, denn um den Musik-Wettbewerb die Kosten für die Ausrichtung eines Eurovision Song Contests bewegen sich im zweistelligen Millionenbereich. Und während ein Favorit wie Berlin Anfang der 2000er-Jahre noch als »arm aber sexy« galt, konnte Düsseldorf bereits auf eine mehrjährige Schuldenfreiheit zurückblicken.
Eine Chance, welche die Stadt am Rhein nur allzu gerne ergriff und so wurde der Eurovision Song Contest für Düsseldorf schnell zum Prestigeprojekt: »Es gibt ja in Düsseldorf ein Problem, man könnte fast sagen, es ist ein Komplex: nämlich die internationale Bekanntheit – oder Unbekanntheit«, brachte es der Marketing-Experte Bernd Günther damals treffend gegenüber der »Frankfurter Rundschau« auf den Punkt. Um die Chance des internationalen Renommees zu nutzen, musste jedoch zuerst investiert werden – und das nicht zu knapp. Schon 2011 sah sich der damalige Oberbürgermeister kritischen Fragen zur Finanzierung ausgesetzt. »Wir hätten uns nicht beworben, wenn wir das Ganze nicht stemmen könnten«, bekräftigte er damals.
Ist der ESC noch zeitgemäß?
15 Jahre später stellt sich angesichts einer unsicheren Wirtschaftslage und einer drohenden Rezession die Frage nach dem nutzen des finanziellen Aufwands erneut: Sollte Deutschland also überhaupt weiterhin in den ESC investieren, geschweige denn auf einen Sieg hoffen? Immerhin wird allein die Summe, die Deutschland in diesem Jahr an die European Broadcasting Union (EBU) zahlt, auf 451.216 Euro geschätzt. Und die Konkurrenz ist nicht nur auf der Bühne groß – auch die Austragungsorte überbieten sich gegenseitig mit aufwendigen Inszenierungen, technologischen Innovationen und riesigen Bühnenproduktionen. Die bisher teuerste Veranstaltung fand 2012 in Aserbaidschan statt: Rund 60 Millionen Euro wurden für den Wettbewerb veranschlagt.
Doch es gibt Hinweise darauf, dass die Austragung des ESC wirtschaftliche Vorteile bergen kann. Denn wenn über 30 Nationen um den besten Song konkurrieren, erhält auch der Austragungsort viel Sendezeit – sei es über die traditionellen Einspieler zwischen den Beiträgen, die spektakulären Kamerafahrten über die Veranstaltungen oder nur die bloße Erwähnung. Seiten der Stadt Wien, die sich im Jahr 2015 als Gastgeber des Song Contests verantwortlich zeichnete, hieß es etwa, der Wettstreit habe eine Bruttowertschöpfung von 38,1 Millionen Euro für ganz Österreich erzielen können; davon entfielen 27,8 Millionen Euro nur auf Wien. Über 500 Vollzeitarbeitsplätze seien im direkten Zusammenhang mit diesem Event geschaffen worden, ist in einer Untersuchung des »Instituts für höhere Studien« zu lesen. Darüber hinaus habe der Contest auch langfristige, positive Folgen für die österreichische Infrastruktur: Die für den Wettbewerb notwendigen Adaptierungsarbeiten der Wiener Stadthalle seien beispielsweise auch für spätere Veranstaltungen genutzt worden. Zusätzlich seien Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich feststellbar gewesen, was sich insbesondere am aufgewerteten Image der Label »Made in Austria« und »Made in Vienna« zeige. Auch in Liverpool, der Gastgeberstadt von 2023, wurden positive Effekte gemessen. Hier konnte die Region durch den ESC Einnahmen in Höhe von 54,8 Millionen Pfund erzielen.
Germany, 12 Points? Das sind die Favoriten
Ein Sieg beim Eurovision Song Contest wäre also aus wirtschaftlicher Sicht durchaus wünschenswert. Aber ist er auch wahrscheinlich? Laut den Prognosen steigen die Chancen für den diesjährigen deutsche Beitrag von Abor & Tynna zwar stetig an, aber die Wettquoten sehen insbesondere die Länder Schweden, Österreich und Frankreich als Favoriten an.
Trotz aller Ungewissheiten aber bleibt die Hoffnung auf eine erfolgreiche ESC-Teilnahme, denn der Wettbewerb ist weit mehr als nur ein finanzielles Risiko: Er bietet eine einzigartige Werbeplattform für das Gastgeberland, fördert den Tourismus und sorgt zumindest punktuell für internationale Aufmerksamkeit. Vielleicht hilft den diesjährigen Teilnehmern ein Tipp von ESC-Star Lena Meyer-Landrut, die im Jahr 2010 in Oslo triumphierte. Ihr Erfolgsgeheimnis? Ganz simpel: »Nicht so viel denken, atmen, noch was trinken – und das war’s. Lampenfieber hat man immer, man ist immer nervös, deshalb lässt sich das nicht trainieren, schätze ich.«
Beitragsbild: IMAGO / ANP (RAMON VAN FLYMEN)
AS
Weitere Beträge zum gleichen Thema