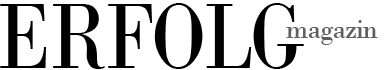Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung – meist die falsche
Ein Gastbeitrag von Christian Fuchs
Wer den Maschinenraum eines Unternehmens betritt, erlebt zunächst das Bild einer scheinbar perfekt abgestimmten Organisation. Quartalszahlen werden erreicht, Teams liefern Ergebnisse, Prozesse laufen wie auf Schienen. Doch unter dieser Oberfläche, dort, wo Dynamik und Richtung entstehen, lassen sich feine Risse erkennen.
Das eigentliche Leck im System bleibt häufig verborgen: Es ist die Entscheidungsschwäche in den Führungsetagen. Entscheidungen werden vertagt, Verantwortlichkeiten verwässert und statt Klarheit dominiert ein Klima der Unverbindlichkeit. Die Folgen sind leise, aber weitreichend: Projekte stagnieren, Teams verlieren an Energie, eine Kultur der Unsichtbarkeit breitet sich aus.
Die innere Haltung zur Verantwortung ist das eigentliche Steuer
In einer Arbeitsumfeld, in der Komplexität, Krisen und permanente Transformation zur Tagesordnung gehören, reicht es längst nicht mehr aus, Führung nur an Ergebnissen zu messen. Entscheidend ist die innere Haltung zur Verantwortung. Eine der folgenreichsten Schwächen, die sich durch alle Ebenen zieht, ist das Unvermögen, klare Entscheidungen zu treffen. Führungskräfte, die zögern, handeln selten aus Gleichgültigkeit. Häufig stehen Überforderung, die Angst vor Fehlern oder der Wunsch, es allen recht zu machen, im Hintergrund. Doch gut gemeint ist nicht gut geführt. Das Ausbleiben von Entscheidungen ist keine neutrale Haltung, es ist eine passive Form der Kontrolle, die Verantwortung kaschiert und Unsicherheit zementiert.
Für Mitarbeiter bedeutet Entscheidungslosigkeit eine besondere Belastung. Wer im Team arbeitet, ist auf Richtung angewiesen. Das Ziel mag sich im Verlauf verändern, aber die Richtung muss erkennbar bleiben. Bleibt Führung unentschieden, entsteht Orientierungslosigkeit, vergleichbar mit einem Schiff, das auf hoher See treibt: Energie wird verbraucht, doch das Ziel bleibt diffus. Über längere Zeit entsteht ein Klima der Resignation. Mitarbeiter ziehen sich innerlich zurück, treffen eigene Entscheidungen im Verborgenen oder reduzieren ihr Engagement auf das Notwendigste. Wo Klarheit fehlt, entsteht keine Bindung, sondern ein Pakt der Unsichtbarkeit: »Ich mache meinen Job, aber erwarte nichts weiter.«
Unternehmerisch betrachtet ist zögerliche Führung ein Produktivitätskiller. Entscheidungen sind der Treibstoff, der Prozesse am Laufen hält, Budgets freigibt und Projekte finalisiert. Jede vertagte Entscheidung zieht einen Rattenschwanz nach sich: Liefertermine geraten ins Wanken, das Vertrauen der Mitarbeitenden schwindet, Kundenbeziehungen leiden. Noch gravierender ist die schleichende Etablierung einer Kultur des Mittelmaßes. Wo niemand entscheidet, entsteht keine Spitzenleistung. Exzellenz braucht Fokus, und Fokus verlangt Auswahl. Wer alles offenlässt, bleibt im Sumpf der Optionen stecken.
Warum fällt Entscheiden so schwer?
Die Ursachen für Entscheidungsschwäche in Führungsetagen sind vielfältig und meist tief im System verankert:
- Angst vor Fehlern: In einer Leistungskultur, in der Fehler stigmatisiert werden, wird jede Entscheidung zur potenziellen Risikoquelle.
- Kultur der Absicherung: Organisationen belohnen häufig Konsens und politische Klugheit mehr als Klarheit und Mut.
- Überforderung durch Komplexität: Die Vielzahl an Möglichkeiten lähmt. Statt zu entscheiden, wird weiter analysiert.
- Perfektionismus: Die Suche nach der perfekten Lösung verhindert die gute Entscheidung im richtigen Moment.
Was echte Führung braucht, ist Mut, Klarheit, Verantwortung
Der Weg aus der Entscheidungsfalle führt nicht über weitere Tools oder komplexere Vorlagen. Es braucht eine innere Haltung, die sich an drei Schlüsselqualitäten orientiert:
- Mut zur Unvollkommenheit: Nicht jede Entscheidung muss perfekt sein. Entscheidend ist, zu erkennen, was jetzt notwendig ist und dies umzusetzen.
- Klarheit in der Kommunikation: Eine klare Entscheidung verlangt eine klare Botschaft und die Bereitschaft, dafür einzustehen.
- Verantwortung für die Wirkung: Wer führt, trägt Verantwortung, auch für die Folgen der eigenen Entscheidungen. Diese Haltung schafft Vertrauen.
Lässt sich Entscheidungsstärke trainieren?
Niemand wird als Führungspersönlichkeit geboren. Entscheidungsbereitschaft ist eine Fähigkeit, die sich üben lässt, etwa durch:
- Entscheidungs-Tagebücher: Die Reflexion darüber, wann und wie Entscheidungen getroffen wurden und welche Auswirkungen sie hatten.
- Sparring: Der Austausch mit neutralen Partnern, um Optionen zu klären und blinde Flecken zu erkennen.
- Klarheits-Routinen: Tägliche Reflexionszeiten, in denen bewusst geprüft wird, wo eine Entscheidung notwendig ist.
Fazit – Wer nicht entscheidet, wird ersetzt
In Zeiten, in denen Wandel zur Norm geworden ist, ist Entscheidungsstärke keine optionale Kompetenz mehr. Sie ist Voraussetzung für Vertrauen, Tempo und Wirksamkeit. Führung bedeutet nicht, alles zu wissen, sondern bereit zu sein, Verantwortung zu tragen, auch dann, wenn nicht alle Informationen vorliegen. Denn am Ende ist keine Entscheidung eben doch eine Entscheidung. Nur selten die richtige.

Bilder: Christian Fuchs, IMAGO / Dreamstime
Weitere Beträge zum gleichen Thema