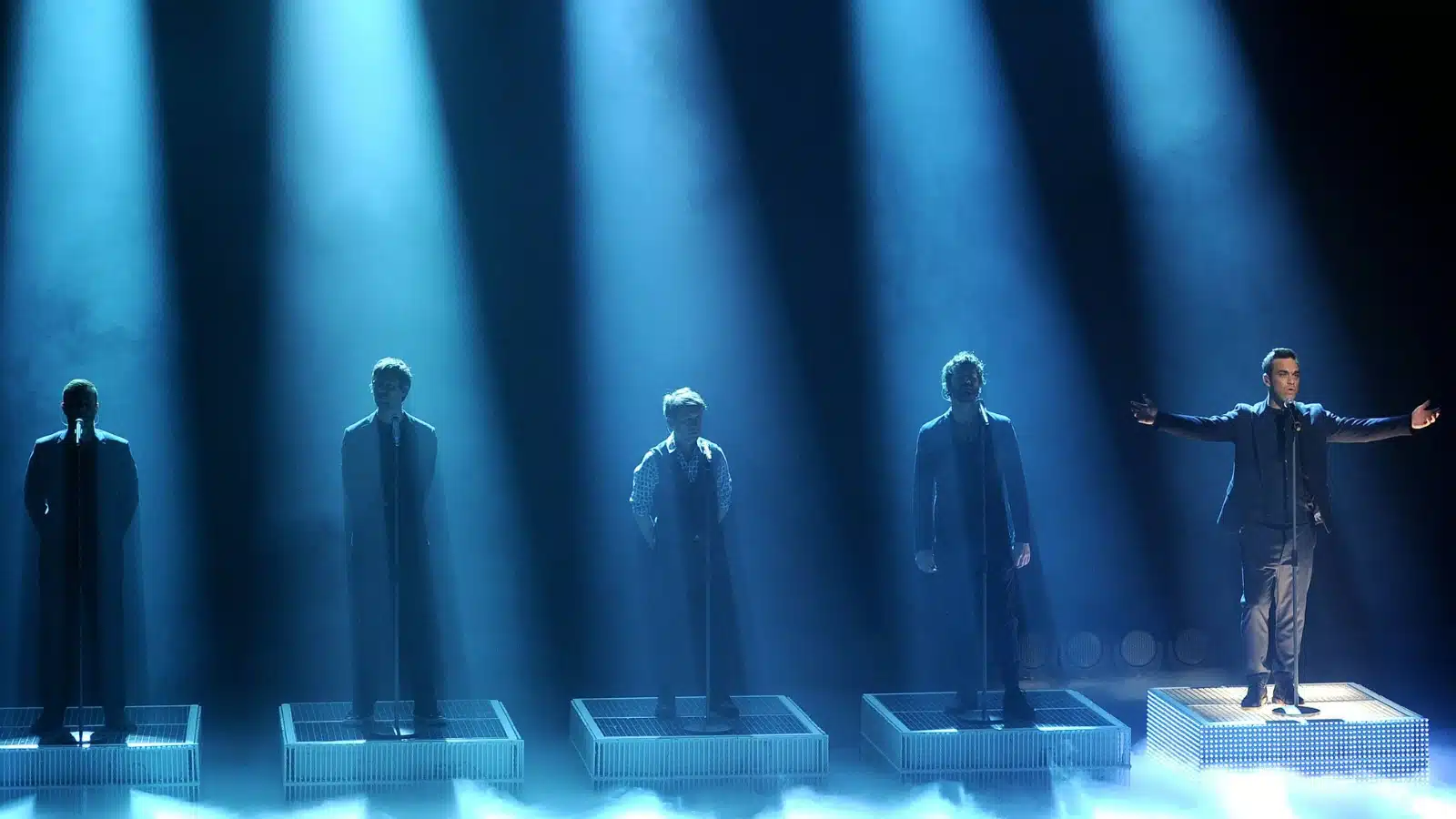-
×
Aktionspaket 10 für 10
Aktionspaket 10 für 10
1 × 10,00 €

Standortschließungen richtig managen – Kommunikation als Schlüssel zum Erfolg
Ein Expertenbeitrag von Uwe Rembor
Wenn Unternehmen vor der Entscheidung stehen, einen Standort zu schließen, ist das meist das Ergebnis von monatelangen Analysen, strategischen Überlegungen und nicht selten auch schmerzhaften Abwägungen. Für das Management bedeutet eine Standortschließung, wirtschaftlich notwendige Entscheidungen umzusetzen, die das Überleben des Unternehmens sichern sollen. Für die Mitarbeiter ist es jedoch häufig ein Schock, der mit Angst, Wut und Frustration einhergeht.
Der entscheidende Erfolgsfaktor in dieser Situation ist die richtige Kommunikation. Sie bestimmt, ob die Übergangsphase kontrolliert und geordnet verläuft oder ob Chaos, Gerüchte und massenhafte Kündigungen die Umsetzung gefährden.
Die psychologische Dimension
Menschen reagieren auf die Ankündigung einer Standortschließung nicht rational, sondern emotional. Selbst langjährige Loyalität kann innerhalb weniger Stunden in Resignation oder Widerstand umschlagen. Gerade in dieser Phase müssen aber noch Aufträge abgearbeitet, Maschinen betreut und Kundenbeziehungen gepflegt werden.
Wer hier falsch kommuniziert, riskiert, dass Mitarbeiter scharenweise kündigen oder sich krankmelden. Das Tagesgeschäft bricht zusammen, Kunden verlieren Vertrauen, und der wirtschaftliche Schaden vervielfacht sich. Deshalb muss Kommunikation im Restrukturierungsprozess strategisch geplant und präzise getaktet sein.
Die richtige Reihenfolge der Kommunikation
Eine häufige Frage lautet: Wen informiert man zuerst – Betriebsrat, Mitarbeiter, Öffentlichkeit, Kunden? Die Reihenfolge ist entscheidend.
- Zuerst der Betriebsrat:
Nach §111 BetrVG ist der Arbeitgeber verpflichtet, den Betriebsrat frühzeitig und umfassend über geplante Betriebsänderungen zu informieren. Dazu zählen Standortschließungen, Verlagerungen oder Massenentlassungen. Ein Verstoß kann rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. - Dann die Mitarbeiter:
Die Belegschaft sollte direkt nach den ersten Gesprächen mit dem Betriebsrat informiert werden – und zwar durch die Geschäftsführung persönlich, nicht durch eine Pressemitteilung. Die Art der Ansprache entscheidet darüber, ob Vertrauen zumindest teilweise erhalten bleibt. - Anschließend die Öffentlichkeit und Kunden:
Erst wenn die internen Stakeholder informiert sind, sollte die Kommunikation nach außen erfolgen. Kunden und Medien reagieren sehr sensibel, wenn sie von einer Schließung aus der Zeitung erfahren, bevor der Ansprechpartner im Unternehmen sie kontaktiert hat.
Diese Reihenfolge ist zwingend einzuhalten, um Vertrauen, Rechtssicherheit und Handlungsfähigkeit zu gewährleisten.
Der Sozialplan – Balance zwischen Interessen
Ein zentraler Bestandteil jeder Standortschließung ist der Sozialplan. Dieser wird zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat verhandelt und soll wirtschaftliche Nachteile für die Mitarbeiter abfedern. Dazu gehören Abfindungen, Umschulungen oder Unterstützung bei der Jobsuche.
Hier gilt: Transparenz schafft Akzeptanz. Je klarer das Management die wirtschaftliche Notwendigkeit darlegt, desto eher ist der Betriebsrat bereit, konstruktiv zu verhandeln. Zugleich darf der Sozialplan die Restrukturierung nicht finanziell erdrücken – eine Balance zwischen sozialer Verantwortung und wirtschaftlicher Vernunft ist entscheidend.
Die Rolle des Interim Managers
In vielen Fällen wird ein Interim CRO oder Restrukturierungsexperte eingesetzt, um den Prozess professionell zu begleiten. Seine Rolle:
- Neutralität: Als externer Manager ist er nicht Teil historischer Konflikte.
- Expertise: Er kennt rechtliche Rahmenbedingungen, Best Practices und typische Fallstricke.
- Stabilität: Er sorgt dafür, dass operative Abläufe nicht zusammenbrechen und die Kommunikation strukturiert verläuft.
Gerade bei sensiblen Themen wie Massenentlassungen oder Standortverlagerungen ist diese externe Steuerung oft der Schlüssel zum Erfolg.
Kommunikation als kontinuierlicher Prozess
Eine einmalige Ankündigung reicht nicht. Kommunikation muss während der gesamten Abwicklungsphase kontinuierlich stattfinden. Regelmäßige Updates, persönliche Ansprechpartner und offene Fragerunden sind unverzichtbar, um Unsicherheiten abzufangen.
Besonders wichtig: Führungskräfte müssen sichtbar sein. Wer sich in sein Büro zurückzieht, verliert sofort Glaubwürdigkeit. Mitarbeiter erwarten Präsenz, Zuhören und Antworten – auch wenn diese unbequem sind.
Fallstricke in der Praxis
Typische Fehler, die Unternehmen in der Kommunikation bei Standortschließungen machen, sind:
- Überraschungseffekt: Mitarbeiter erfahren aus der Presse von der Schließung.
- Unklare Botschaften: Widersprüchliche Aussagen verstärken Verunsicherung.
- Fehlende Perspektiven: Wer nur sagt, was wegfällt, ohne Perspektiven aufzuzeigen, erzeugt Widerstand.
- Ignorieren der Emotionen: Rein rationale Argumente greifen nicht – Mitarbeiter wollen ernst genommen werden.
Diese Fehler führen fast zwangsläufig zu Kündigungswellen, Krankmeldungen und Motivationsverlust – und gefährden damit den gesamten Abwicklungsprozess.
Best Practices für eine gelungene Schließungskommunikation
- Frühzeitige Planung: Kommunikationsstrategie parallel zur strategischen Entscheidung entwickeln.
- Klarheit: Keine verschleiernden Formulierungen, sondern klare Fakten.
- Empathie: Verständnis für Sorgen zeigen, aktiv zuhören.
- Transparenz: Regelmäßig informieren, auch wenn es keine neuen Ergebnisse gibt.
- Perspektiven bieten: Outplacement, Umschulungen oder neue Chancen aktiv aufzeigen.
So wird aus einer reinen Verlustgeschichte zumindest ein kontrollierter und respektvoller Übergang.
Fazit
Eine Standortschließung ist immer ein tiefer Einschnitt – für Mitarbeiter, Management und Unternehmen. Ob sie geordnet und wirtschaftlich sinnvoll umgesetzt werden kann, hängt entscheidend von der Kommunikation ab. Wer Betriebsrat, Belegschaft, Kunden und Öffentlichkeit in der richtigen Reihenfolge und mit der richtigen Tonalität anspricht, wahrt nicht nur Rechtssicherheit, sondern auch Vertrauen.
Am Ende entscheidet nicht allein die wirtschaftliche Notwendigkeit, sondern die Art und Weise, wie man miteinander umgeht. Unternehmen, die diesen Grundsatz beherzigen, können selbst in der Krise Reputation und Handlungsfähigkeit bewahren – und damit die Basis für einen Neuanfang schaffen.

Uwe Rembor ist Interim Manager und auf Restrukturierung, Vertriebsoptimierung und Unternehmensfinanzierung spezialisiert.
Er kann auf über 35 Jahren internationale Führungserfahrung und einem Track Record von mehr als 20 Restrukturierungen zurückblicken.
Zudem wurde er 2023, 2024 und 2025 als Exzellenzberater der Deutschen Wirtschaft ausgezeichnet und ist TOP3 Führungskraft Vertrieb DACH.
Beitragsbild: Depositphotos / imtmphoto, privat
Weitere Beträge zum gleichen Thema
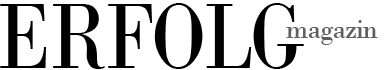
 Aktionspaket 10 für 10
Aktionspaket 10 für 10