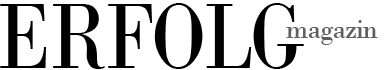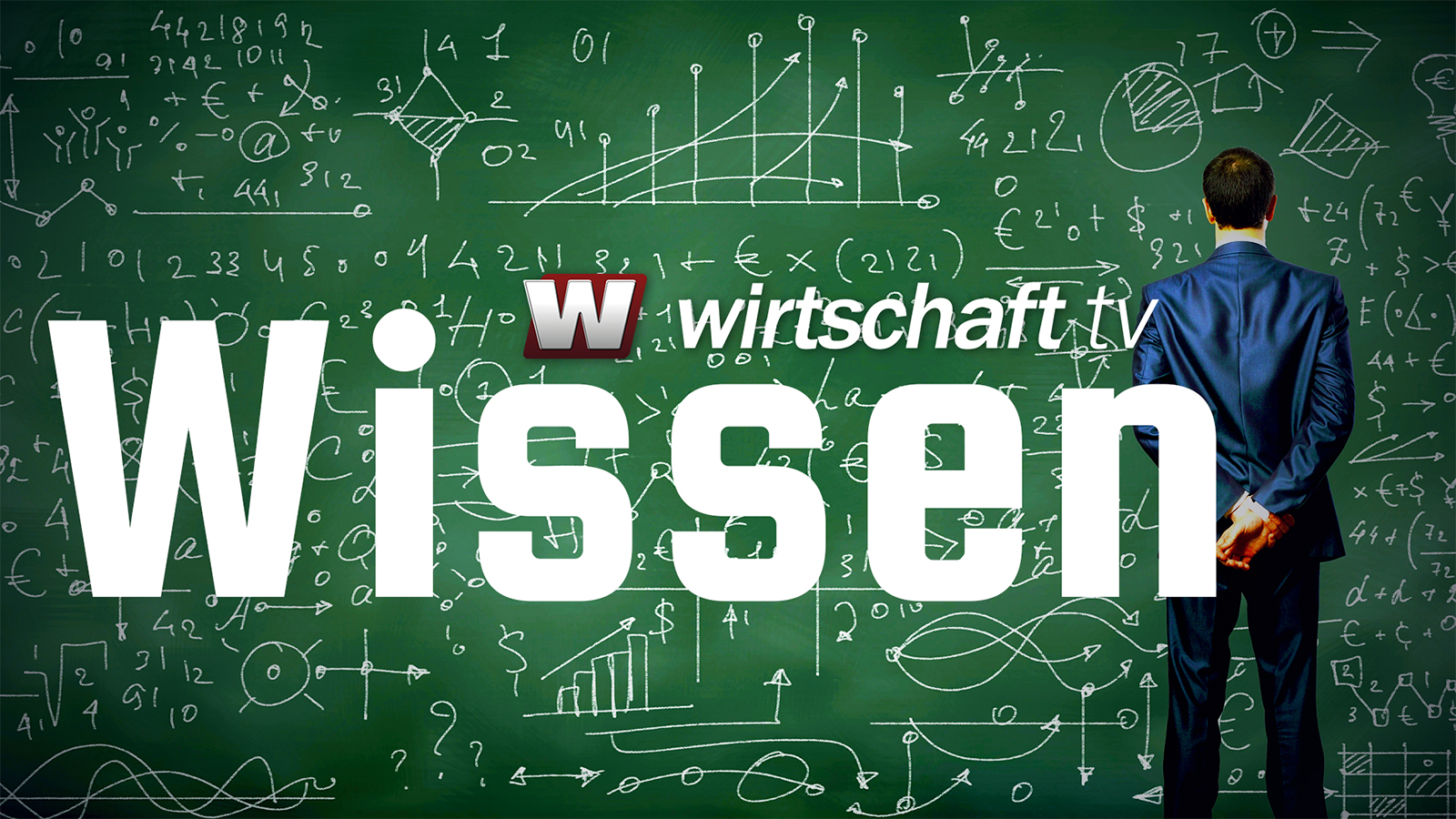Sir Richard Branson: No Limits!
Sir Richard Branson gehört zu den außergewöhnlichsten Unternehmerpersönlichkeiten unserer Zeit. Mit seinem Innovationsgeist, seinem Mut zu kalkulierten Risiken und seinem fast schon spielerischen Umgang mit Herausforderungen prägte er nicht nur bestehende Branchen, sondern schuf auch völlig neue. Die von ihm gegründete Virgin Group ist eine ungewöhnliche Mischung aus Marken-Leveraging, Risikostreuung und seiner Inszenierung als Anti-CEO. Es bieten sich Vergleiche mit prägenden Persönlichkeiten wie Steve Jobs oder Bill Gates an, doch die Schnittmenge ist kleiner als vermutet, weil Sir Richard Branson eine »Gesamtfigur« ist. Es gibt für sein Wirken sicher keine Blaupause. Aber Erfolgsfaktoren.
Der junge Branson legt das Korsett Schule ab
Sein außergewöhnliches unternehmerisches Talent zeigte sich bereits früh. Seine schulischen Leistungen waren nicht gut, Richard Branson hat Dyslexie, eine Lese- und Rechtschreibschwäche. Also gründete er mit 16 Jahren sein erstes Unternehmen – ein Jugendmagazin, mit dem er Spenden für wohltätige Zwecke sammelte. Von da an war er Unternehmer, ging einfach seinen Weg in entgegengesetzte Richtung – weg vom Korsett Schule. Das Projekt Jugendmagazin war wirtschaftlich nicht erfolgreich. Aber schon zu diesem Zeitpunkt zeigt er, dass Scheitern für ihn kein Makel zu sein scheint, sondern vielmehr die Aufforderung, sich ein neues Konzept zu überlegen. 1970 startete er dann Virgin Records als Postversandhandel für Schallplatten. Die Idee entstand aus einer Lücke im Markt: Britische Plattenläden erhöhten damals aufgrund einer eingeführten Mehrwertsteuer die Preise. Branson umging dies durch Direktvertrieb und nutzte gleichzeitig eine gesetzliche Grauzone, indem er die Platten als Exporte deklarierte. Dafür handelte er sich eine hohe Geldbuße ein. Danach stellte er den Direktvertrieb wieder ein und wandelte ihn in einen regulären, stationären Handel um. Diese Flexibilität im Umgang mit Rückschlägen wurde ein wiederkehrendes Element seines Tuns.
Sein nächster Schritt: Er gründete die Manor Studios in Oxfordshire und das Label »Virgin«, um Musik zu produzieren und Musikern einen Raum zu geben. 1972 nahm er den noch unbekannten Bassisten Mike Oldfield unter Vertrag. Das Debütalbum »Tubular Bells« wurde ein Riesenerfolg. Unter anderem machte Branson auch Verträge mit den »Sex Pistols« und den »Rolling Stones«. Als er beschloss, das nächste Unternehmen zu gründen – »Virgin Atlantic« – musste er das Plattenlabel verkaufen, um an Kapital zu kommen. Das war ein Tiefschlag für ihn. Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters sagte er später, das habe sich angefühlt, als müsse man seine Kinder verkaufen, auch wenn der Deal sehr lukrativ gewesen sei. »Virgin Atlantic« war ein Meilenstein in der Unternehmerkarriere. »Der schnellste Weg, eine Airline aufzubauen war aus meiner Sicht, zunächst ein einziges Flugzeug zu leasen«, schreibt er auf seinem Blog. Alle hätten ihn für verrückt erklärt. Doch er konnte Boeing überzeugen, ihm eine 747 zu leasen. Er wagte etwas völlig Neues, ließ sich nicht verunsichern.
Dennoch sicherte er das Risiko ab: Er hat ausgehandelt, das Flugzeug im Falle des Scheiterns wieder zurückgeben zu können. Das ist jetzt rund 40 Jahre her – und »Virgin Atlantic« existiert immer noch. Am 22. Juni 1984 startete der Flug VS1 von London-Gatwick mit Ziel Newark Liberty International Airport in New Jersey. Der Jumbojet, der erst wenige Tage zuvor in London eingetroffen war, hob mit Bransons Freunden und Familie, Mitarbeitern, Medienvertretern und 70 Kisten Champagner an Bord ab. »Die Leute tanzten in den Gängen, während wir Madonnas ›Like A Virgin‹, Culture Club und Phil Collins spielten«, schrieb Branson in seiner Autobiografie.
Viele Versuche führen ans Ziel
Branson spielte weiter auf dem globalen Spielfeld. Nach und nach schuf er mit der »Virgin Group« einen der größten Mischkonzerne der Welt. Das Konglomerat vereint Marken aus unterschiedlichsten Branchen, darunter Reisen, Telekommunikation, Unterhaltung und Raumfahrt. Branson strukturierte die Group nicht als zentralisiertes Unternehmen, sondern als Netzwerk eigenständiger Firmen unter einem Dach. Jede von ihnen operiert autonom, aber jede gehört zur Marke »Virgin«.
Richard Branson bediente sich gerne einer Guerilla-Marketing-Strategie, die er global anwandte. Als »Virgin Atlantic« in den 1980er-Jahren gegen »British Airways« antrat, inszenierte er den Kampf öffentlich als »David gegen Goliath« – unterstützt durch PR-Coups wie das Anheuern von Piloten von »British Airways« während eines Streiks, oder den Größen-Vergleich der Business-Class-Sitze in Zeitungsanzeigen. Als BA später eine Kampagne gegen Virgin startete (»Dirty Tricks«-Skandal), verklagte Branson das Unternehmen und spendete die ausgehandelte Entschädigung an seine Mitarbeiter. Das war öffentlichkeitswirksam und hallte nach: Diese Aktionen festigten das Image als Underdog, obwohl »Virgin Atlantic« längst multinational agierte.
Eines seiner wohl ambitioniertesten Projekte ist das Raumfahrtunternehmen »Virgin Galactic«, das er 2004 gründete. Sein Ziel: kommerziellen Weltraumtourismus zu ermöglichen. Nach zahlreichen Rückschlägen und intensiven Testphasen startete er am 11. Juli 2021 mit seinem eigenen Raumschiff »VSS Unity« ins All und bewies der Welt, dass private Raumflüge keine Utopie und Limits bloße Theorie sind. Branson sagte während des Fluges an die jüngeren Generationen gerichtet in die Kamera: »Wenn wir das hier geschafft haben, was könnt ihr dann erst schaffen?« Er selbst hatte es übrigens geschafft, neun Tage vor seinem »Konkurrenten« Jeff Bezos ins All zu fliegen, und sich so die Vorreiterrolle auf dem privaten Sektor zu sichern.
Agile Spielzüge auf dem globalen Feld
Sir Richard Branson gehört zu den Persönlichkeiten, für die Scheitern kein Fehler ist, sondern ein Versuch – ein Credo vieler erfolgreicher Menschen. Viele Virgin-Unternehmen wie »Virgin Cars« oder »Virgin Digital« konnten sich nicht durchsetzen. Aber das war ohnehin kalkuliertes Risiko. Sein Ansatz, schnell in neue Märkte einzutreten und bei Misserfolgen ebenso schnell zurückzuziehen, wurde Teil der Strategie. So testete er mit »Virgin Cola«, ob er gegen »Coca-Cola« konkurrieren kann, zog sich aber zurück, als die Kampagne in den USA nicht funktionierte. Dass Sir Richard Branson angstfrei ausprobierte, was aus seiner Sicht viel-
versprechend war, heißt aber nicht, dass er in Kauf nehmen würde, Geld zu verbrennen. Finanziell vermied er hohe Eigeninvestitionen. Stattdessen setzte er auf Joint Ventures oder Franchising-Modelle. Diese »kleine« Schnittstelle zwischen Vision und Umsetzung dürfte einer der Gründe für seinen Erfolg sein. »Virgin Galactic« wurde zum Beispiel über SPACs an die Börse gebracht, um Kapital einzusammeln. Im Gegensatz zu kapitalintensiven Global Playern wie »Amazon« oder »Tesla« verfolgt Virgin eine Asset-Light-Strategie und nutzt möglichst bestehende Infrastrukturen.
Sir Richard Branson ist in der öffentlichen Wahrnehmung nicht nur Unternehmer oder Privatmensch, vielmehr zerfließen die Grenzen. Er ist offensichtlich von einer ganz eigenen Energie getrieben, so wie viele Erfolgsmenschen. Zudem hat er sehr früh erkannt, dass seine Dyslexie kein Defekt oder Makel ist. Aus seiner Sicht ermöglicht sie es ihm, anders zu denken und kreative Lösungen zu finden – er nennt es seine »Superpower«. Der Milliardär setzt sich deshalb aktiv für dieses Thema ein, hat die gemeinnützige Organisation »Unite BVI« ins Leben gerufen, um auf dieses Thema aufmerksam zu machen und Menschen mit Dyslexie vom Stigma der intellektuellen Unvollständigkeit zu befreien. Auf seinem Blog schreibt er: »Die Welt muss verstehen, dass die Fähigkeiten, die dyslexische Menschen mitbringen – etwa Problemlösung, Kreativität, Anpassungsfähigkeit und Kommunikation – zu den gefragtesten Kompetenzen in nahezu jeder Branche gehören. Wir müssen aufhören, quadratische Bausteine in runde Löcher pressen zu wollen!« Dyslexisches Denken fördere Innovation, löse komplexe Probleme und bringe visionäre Ideen hervor. Und: »Einige der erfolgreichsten Unternehmer, Künstler und Pioniere – von Albert Einstein und Steve Jobs bis Pablo Picasso – waren dyslexisch. Stell dir vor, sie hätten ihr Potenzial nie entdeckt!«
MK
Bild: IMAGO / Newscast
Dieser Artikel ist ursprünglich in voller Länge in der Printausgabe 3/2025 des ERFOLG Magazins erschienen.
Weitere Beträge zum gleichen Thema